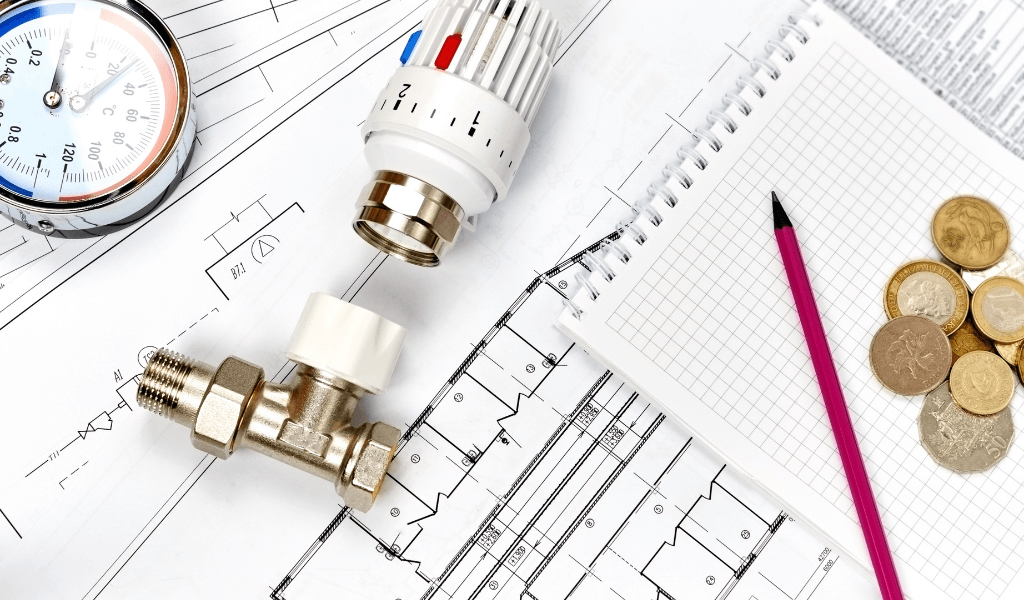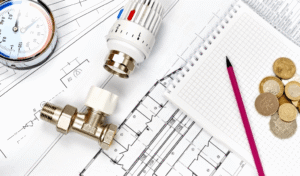Begriffserklärungen: Gebäudeenergiegesetz
Häufig kommen Fragen auf, was bei einem Austausch oder Einbau von Heizgeräten, sowie bei bestehenden Heizungen gesetzlich zu beachten ist. Vor allem im Zusammenhang mit der kommunalen Wärmeplanung, die derzeit in den Kommunen der Region Hannover aufgestellt wird, kursieren Fristen, Optionen und viele Möglichkeiten. In diesem Beitrag schauen wir uns daher drei wichtige Begriffe etwas genauer an und legen die Auswirkungen auf Bürger:innen in der Region Hannover dar.
Das Gebäudeenergiegesetz (kurz GEG) ist in der derzeitigen Form seit 1. Januar 2024 das grundlegende Gesetz rund um den Gebäudesektor in Deutschland. Es regelt zum Beispiel Anforderungen an Neubauten und bestehende Gebäude, bildet die Grundlage für die Energieausweise oder legt Anforderungen an neue Heizungsanlagen fest. Auch welche Maßnahmen grundsätzlich förderfähig sind, steht im GEG. Aus dem Gesetz entstehen auch Pflichten für Gebäudeeigentümer:innen, wie zum Beispiel die zum Einsatz von 65 Prozent erneuerbarer Energien beim Einbau neuer Heizungsanlagen.
Begriffserklärungen: Bundesförderung für effiziente Gebäude
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (kurz BEG), ist eine Richtlinie, in der unter anderem Fördermöglichkeiten für Einzelmaßnahmen (zum Beispiel Austausch von Fenstern), Komplettsanierungen oder Energieberatungen für Gebäude festgelegt werden. Sie ist also die zentrale, bundesweite Grundlage, die Fördermöglichkeiten rund um energetische Modernisierung und den Einsatz erneuerbarer Energien regelt. In der Regel sind dies Zuschüsse oder Kredite/Darlehen, die über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) den entsprechenden Zielgruppen (beispielsweise Gebäudebesitzer:innen) zur Verfügung stehen. Daneben gibt es noch viele landesweite, regionale und lokale Fördermöglichkeiten. Sie finden eine ausführliche Aufstellung in unserem Fördermittelkompass unter https://www.foerdermittelkompass.info
Begriffserklärungen: Kommunale Wärmeplanung
Die kommunale Wärmeplanung (KWP) ist ein strategisches Instrument von Kommunen. Die KWP ist ein langfristig angelegter Prozess, mit dem das Ziel einer weitestgehend klimaneutralen Wärmeversorgung erreicht werden soll. Außerdem kann die Kommune durch quartiersbezogene Ansätze zur verstärkten Nutzung von dezentralen Wärmelösungen (zum Beispiel Wärmepumpen) oder bei der Errichtung und Machbarkeit von Wärmenetzen unterstützen. Durch die kommunale Wärmeplanung allein werden keine Verpflichtungen direkt für Bürger:innen festgelegt.
Detailliertere Informationen zum Hintergrund der kommunalen Wärmeplanung finden Sie bei der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/zielgruppen/kommunen/Kommunale_Waermeplanung.php
Auswirkungen auf Bürger:innen: Welche Heizungen haben ein Betriebsverbot?
Betriebsverbot für fossile Heizungen
Das GEG regelt in §72 ein zentrales Betriebsverbot für Heizkessel mit fossilen Brennstoffen. Diese dürfen maximal bis 31. Dezember 2044 betrieben werden. Ab dem 1. Januar 2045 müssen bis dahin erlaubte „fossile” (auch anteilige) Heizkessel und Ölheizungen mit 100 Prozent erneuerbaren flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden. Der Anteil von etwa Erdgas muss dann hundertprozentig aus „grünen Gasen” bestehen.
Betriebsverbot für ineffiziente, fossile Heizungen
Heizkessel und Ölheizungen, die älter als 30 Jahre sind, dürfen nicht mehr betrieben werden. Sie müssen also möglicherweise bereits vor dem 1. Januar 2045 ausgetauscht werden. Ausnahmen: Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel, sowie Anlagen unter vier oder mit mehr als 400 Kilowatt Nennleistung oder wenn sie Teil einer Hybridheizung mit erneuerbaren Komponenten sind (Solarthermie- oder Wärmepumpen-Hybridheizung). Wenn in einem Wohngebäude mit maximal zwei Wohneinheiten, mindestens eine Wohneinheit von den Eigentümer:innen bereits vor dem 1. Februar 2002 bewohnt wurde, gelten diese Verpflichtungen erst zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang nach dem 1. Februar 2002. Fazit: Die Ausnahmen dürfen also längstens bis 31. Dezember 2044 betrieben werden.
Auswirkungen auf Bürger:innen: 65-Prozent-Erneuerbarer-Energien-Anteil-Regelung (65%-EE)
Heizungen in Neubauten – nur mit mindestens 65%-EE
Seit dem 1. Januar 2024 dürfen in Neubauten nur noch Heizungen mit mindestens 65%-EE in Betrieb genommen werden. Welche Heizlösungen diese Vorgabe erfüllen, ist im GEG geregelt. Eine Ausnahme bilden Neubauten bei der Schließung von so genannten Baulücken. Diese Neubauten werden wie Bestandsgebäude behandelt.
Heizungen in Bestandsgebäuden – Bestandsschutz
In bestehenden Gebäuden (Stichtag vor dem 1. Januar 2024) besteht keine Austauschpflicht (Ausnahmen siehe Betriebsverbot). Bestehende Heizungen dürfen weiter betrieben und repariert werden, bis diese nicht mehr reparabel sind oder von den Eigentümer:innen geplant ausgetauscht werden sollen.
Havarie oder Austausch in Bestandsgebäuden
Wenn die bestehende Heizung auf Grund eines irreparablen Defektes oder beispielsweise wegen zu hoher Betriebskosten vorzeitig ausgetauscht werden muss, dann kann vorübergehend (bis zu festgelegten Stichtagen) eine Heizung mit fossilen Brennmitteln eingebaut und in Betrieb genommen werden, die nicht die 65%-EE-Anteil-Regelung erfüllen.
Diese Heizung muss jedoch steigende Anteile an erneuerbaren Energien aufweisen. Außerdem darf diese Heizung nur eingebaut werden, wenn durch eine Beratung auf die Auswirkungen durch die kommunale Wärmeplanung und eine mögliche Unwirtschaftlichkeit durch eine steigende CO2-Bepreisung hingewiesen wurde. Detailliertere Infos dazu erhalten Sie auch bei der Verbraucherzentrale https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/rahmenbedingungen/co2-steuer/
In Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohner:innen ist der Stichtag der 30. Juni 2026. Dies betrifft in der Region Hannover nur die Landeshauptstadt Hannover. Für alle anderen Umlandkommunen in der Region Hannover ist der Stichtag der 30. Juni 2028. Nach diesen Stichtagen dürfen Heizungen nur neu eingebaut werden, wenn diese einen 65%-EE-Anteil aufweisen.
Eine Ausnahme erfolgt, wenn durch eine kommunale Entscheidung ein Gebiet für den Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes ausgewiesen wird. Hierbei reicht es nicht, ein geplantes Wärmenetz zum Beispiel als Prüfgebiet zu benennen. Das Gebiet muss per kommunalen Beschlusses ein Wärmenetzgebiet sein. Dann beginnt einen Monat nach Bekanntgabe dieses Beschlusses bereits vorzeitig die Anforderung 65%-EE-Anteil.
Ein Beispiel hierfür ist die Landeshauptstadt Hannover. Seit 1. Juli 2025 dürfen im Fernwärmesatzungsgebiet der Landeshauptstadt nur noch Heizungen eingebaut werden, die einen 65%-EE-Anteil erfüllen. Außerhalb des Fernwärmesatzungsgebietes dürfen bis spätestens zum 30. Juni 2026 noch fossile Heizungen eingebaut werden, die einen ansteigenden Anteil an erneuerbaren Energien haben. Ab 1. Januar 2029 15 Prozent, ab 1. Januar 2035 30 Prozent, ab 1. Januar 2040 60 Prozent und ab 1. Januar 2045 100 Prozent.
Übergangsfristen für neu eingebaute Heizungen in Bestandsgebäuden
Selbst nach diesen Stichtagen bleiben Bürger:innen jedoch teils lange Übergangsfristen. Die Übergangsfrist, bis Ihre neu eingebaute fossile Heizung per Gesetz mindestens den 65%-EE-Anteil erfüllen muss, beträgt mindestens fünf Jahre (spätestens jedoch zum 1. Januar 2045).
Diese Übergangsfrist kann sich sogar noch steigern:
- Wenn Ihr Gebäude an ein Wärmenetz angeschlossen wird und Sie einen Liefervertrag mit dem/der Netzbetreiber:in haben, dass in dem Wärmenetz mindestens 65%-EE-Anteile enthalten sind. In diesem Fall ist eine Übergangsfrist von insgesamt zehn Jahren vorgesehen. Unter anderem, weil der Ausbau eines großflächigen Netzes einen langen Vorlauf hat. Geht eine Heizung kaputt, ist übergangsweise auch eine fossile „Pop-Up-Lösung” möglich.
- Ist in der kommunalen Wärmeplanung ein Wasserstoffnetzausbaugebiet ausgewiesen und die Heizung ab spätestens 1. Januar 2045 vollständig auf Wasserstoff umstellbar, gilt die Übergangsfrist bis 31. Dezember 2044.
- Geht in einem dezentral beheizten Gebäude eine Etagenheizung kaputt, sind maximal 13 Jahre Übergangsfrist nach dem Defekt der ersten Etagenheizung möglich. Dies gilt nur, wenn die bisher dezentral geheizten Wohneinheiten zentralisiert werden. Bleibt es bei dezentralen Lösungen, so gilt die grundsätzliche Übergangsfrist von fünf Jahren.
Das ist mir alles zu kompliziert: Wo kann ich mich beraten lassen?
Auf den Webseiten der Kommunen finden Sie lokale Ansprechpersonen und Verweise auf lokale Beratungsangebote. Auch die Angebote der Klimaschutzagentur Region Hannover und ihrer Netzwerkpartner:innen sind in den entsprechenden Kommunen zu finden.
Alle Beratungsangebote mit Übersicht je Kommune finden Sie in unserem Fördermittelkompass. Es gibt telefonische und Onlineangebote, sowie Präsenzveranstaltungen und Beratungen direkt an Ihrem Objekt. In der Regel sind diese kostenlos oder gegen einen geringen Eigenanteil zu erhalten und dienen der Erstberatung.
Meine Heizung will oder muss ich noch nicht ersetzen. Was kann ich jetzt schon tun, um meinen Energieverbrauch zu reduzieren?
Auch ohne einen Austausch der Heizung lässt sich der Energieverbrauch reduzieren. Optimieren Sie den Betrieb der Heizungsanlage so gut es geht zum Beispiel durch Einstellung der Heizkurve. Dies minimiert die Belastungen etwa durch steigende CO2-Preise bereits ohne große Investitionen.
Sie können den Energiebedarf Ihres Gebäudes auch durch entsprechende energetische Modernisierungen senken. Einige Maßnahmen lassen sich bereits ohne großen Aufwand durchführen. Nutzen Sie vorhandene Fördermittel so weit wie möglich. Die Senkung des Energiebedarfs bereitet das Objekt außerdem auf die Nutzung erneuerbarer Energien vor.