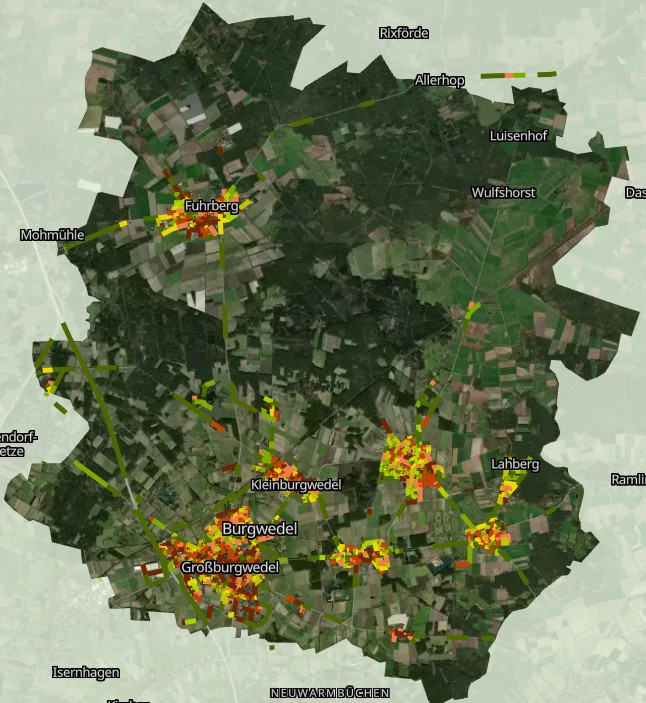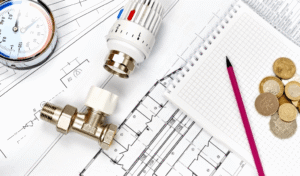Als Wärmequellen können die Außenluft, das Erdreich oder das Grundwasser dienen. Durch den Einsatz von einer Kilowattstunde Strom für den Betrieb der Wärmepumpe können etwa drei Kilowattstunden Wärme aus der Umwelt gewonnen werden – je nachdem, ob die Wärmepumpe nur für die Heizung oder auch für das Brauchwasser genutzt wird. Die Jahresarbeitszahl beträgt im Fall der kombinierten Erzeugung von Heiz- und Brauchwarmwasser etwa 3 oder mehr. Je nach Wärmepumpenart und Gebäude entstehen dabei für Sie als Hausbesitzerin oder Hausbesitzer aber unterschiedliche Kosten bei der Anschaffung und im Betrieb.
1. Die wichtigsten Kostenfaktoren im Überblick
Die Anschaffungskosten beginnen je nach Wärmequelle und erforderlicher Leistung im unteren fünfstelligen Bereich. Erd- und Wasser-Wärmepumpen sind teurer als Luft-Wärmepumpen, da zusätzliche Systemkomponenten und Grabungen bzw. Bohrungen erforderlich sind. Je nach Energiebedarf des Gebäudes kann es sich jedoch lohnen, die höheren Kosten für eine Erdwärmepumpe in Kauf zu nehmen, da diese effizienter arbeitet als Luftwärmepumpen. Alternativ kann geprüft werden, ob eine Kombination aus Photovoltaik und Luftwärmepumpe wirtschaftlicher ist als eine Erdwärmepumpe. Letztlich ist jedoch immer der Einzelfall entscheidend und eine professionelle individuelle Planung und Berechnung ausgesprochen wichtig. Vor der Anschaffung sollten sich Sie über die verfügbaren Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen informieren.
Maßgebend für die Betriebskosten einer Wärmepumpe ist die Jahresarbeitszahl (JAZ). Sie ergibt sich aus dem Verhältnis von jährlich erzeugter Wärmemenge zur dafür eingesetzten Menge an Strom. Bei gasbetriebenen Wärmepumpen spricht man von der Jahresheizzahl (JHZ). Je höher der jeweilige Wert, desto umweltfreundlicher und sparsamer ist das System. Erd- und Wasser-Wärmepumpen schneiden hier deutlich besser ab als Luft-Wärmepumpen. Generell gilt für alle Wärmepumpenarten: Je weniger Energie Sie zuführen müssen, desto effizienter arbeitet eine Wärmepumpe.
Auch das Haus selbst hat direkten Einfluss auf die Kosten. So „benötigt” ein mehrgeschossiger Altbau eine ganz andere Leistung der Wärmepumpe als ein neu gebautes Einfamilienhaus nach Passivhausstandard. Relevant für eine möglichst hohe Wärmepumpeneffizienz ist eine geringe Vorlauftemperatur: Je niedriger die Temperatur ausfällt, auf die das Heizungswasser erwärmt werden muss, desto geringer ist der Stromverbrauch der Wärmepumpe. Die Vorlauftemperatur kann dann besonders niedrig gewählt werden, wenn das Gebäude über eine niedrige spezifische Heizlast verfügt und die Heizflächen ausreichend groß dimensioniert sind. Generell sollte die Vorlauftemperatur bei Norm-Außentemperatur (eine sehr niedrige Temperatur, die fast nie auftritt) nicht oberhalb von 55 °C liegen.
2. Kosten reduzieren
Durch Inverter geregelte Wärmepumpen, kann sich die Wärmepumpe stufenlos an den Wärmebedarf des Hauses anpassen ohne sich dafür ständig ein- und auszuschalten. Das erhöht die Lebensdauer der Wärmepumpe und verringert somit Kosten.
Besonders für Hausbesitzende ist die Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage eine attraktive Investition. Sie kann kostenlose Sonnenenergie in Strom verwandeln, der Wärmepumpe zuführen und das System auf diese Weise noch wirtschaftlicher machen. Die Qualität der Wärmepumpe und der angebotene Kundenservice sind ebenfalls kostenrelevant und sollten in Ihre Kaufentscheidung einfließen. Wir empfehlen deshalb Wärmepumpen, die mit dem Gütesiegel des europäischen Wärmepumpenverbands EHPA ausgezeichnet sind.

3. Preise und Kosten von Luft-Wärmepumpen
Luft-Wasser-Wärmepumpen nutzen die Wärmeenergie der Außenluft und geben sie wahlweise an die Heizung und zur Warmwassererzeugung ab. Die Anschaffungskosten einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Einfamilienhaus liegen im unteren fünfstelligen Bereich. Luft-Wärmepumpen haben eine geringere durchschnittliche Jahresarbeitszahl (JAZ) als Erd- und Wasser-Wärmepumpen, wodurch etwas höhere Stromkosten im laufenden Betrieb entstehen.
4. Preise und Kosten von Erd-Wärmepumpen
Für Sole-Wasser-Wärmepumpen können mit Sole-Flüssigkeit gefüllte Heizschlangen zur Wärmegewinnung aus dem Erdreich z. B. flächig horizontal als Kollektoren oder vertikal als Sonden verlegt werden. Auch Erdwärmekörbe oder Ringgrabenkollektoren eignen sich zur Gewinnung von Erdwärme. Entsprechend werden für Erdwärmepumpen zusätzliche Systemkomponenten benötigt; dazu gehören z. B. Grabungen oder Bohrungen. Dieser Mehraufwand resultiert in höheren Kosten gegenüber Luftwärmepumpen. Für Erd-Wärmepumpen sind die Installationskosten deutlich höher, da Erdarbeiten und/oder Bohrungen nötig sind. Es können zusätzliche Kosten für die Zuwegung entstehen, um Arbeitsgerät wie Bohrer und Bagger für die Erdarbeiten aufs Grundstück bringen zu können. Bei bereits bestehenden Gärten z. B. im Bestand kann eine Gartenneugestaltung finanziell ins Gewicht fallen. Ebenso sollten Sie beachten: Erd-Wärmepumpen sind genehmigungspflichtig. Dafür punkten sie mit geringeren Stromkosten und einer höheren Jahresarbeitszahl (JAZ) als Luft-Wärmepumpen. In einem Einfamilienhaus mit einem Jahresheizwärmebedarf von 17.000 Kilowattstunden können Sie gegenüber einer Luft-Wärmepumpe geschätzte 400 Euro für Stromkosten einsparen.
5. Preise und Kosten von Wasser-Wärmepumpen
Wasser-Wasser-Wärmepumpen nutzen die Umweltwärme des Grundwassers fürs Heizen und die Warmwassererzeugung. Das erfordert einen Förderbrunnen sowie einen Schluckbrunnen und damit zwei Bohrungen. Hinzu kommen im Vorfeld Kosten für eine Probebohrung und eine Wasseranalyse. Außerdem sind Wasser-Wärmepumpen wie Erd-Wärmepumpen genehmigungspflichtig und machen eine Zuwegung für das Bohrgerät erforderlich. Auch diese Variante ist teurer als eine Luftwärmepumpe. Im laufenden Betrieb überzeugt sie allerdings aufgrund der konstanten Temperatur des Grundwassers und der höchsten Jahresarbeitszahl (JAZ) aber mit der höchsten Effizienz der drei vorgestellten Wärmepumpenarten.
Bildquelle: © anatoliy_gleb, © klikkipetra | shutterstock.com